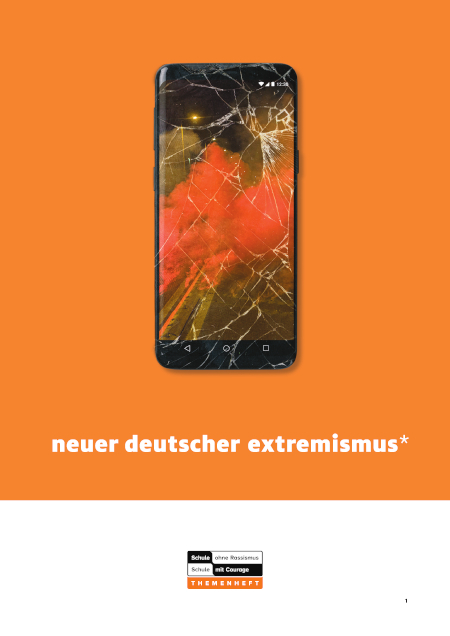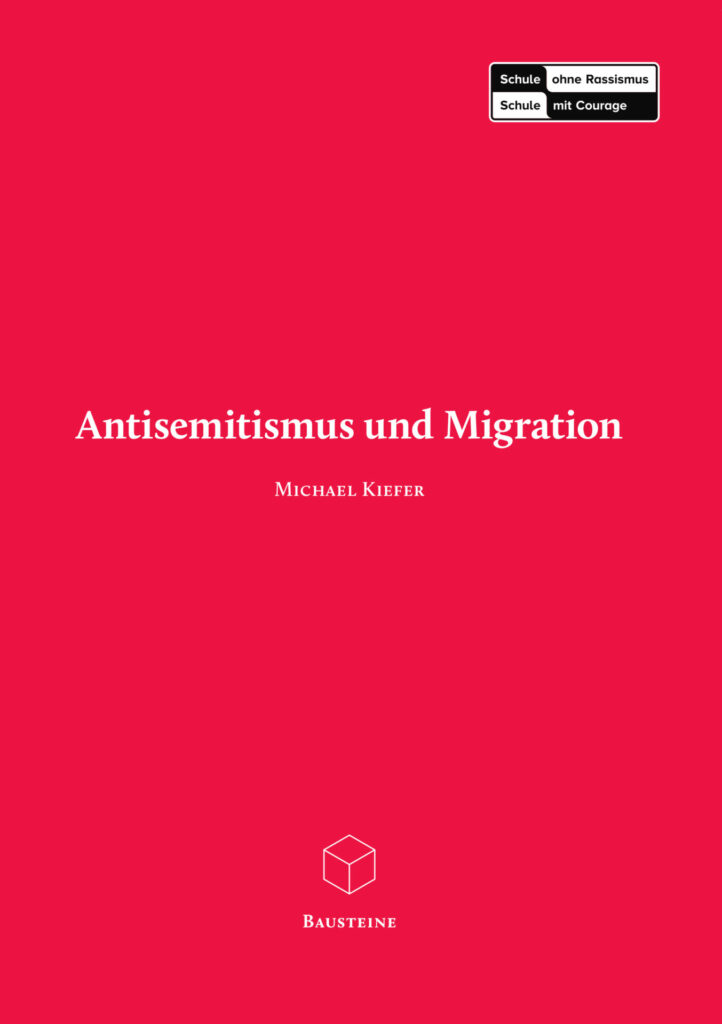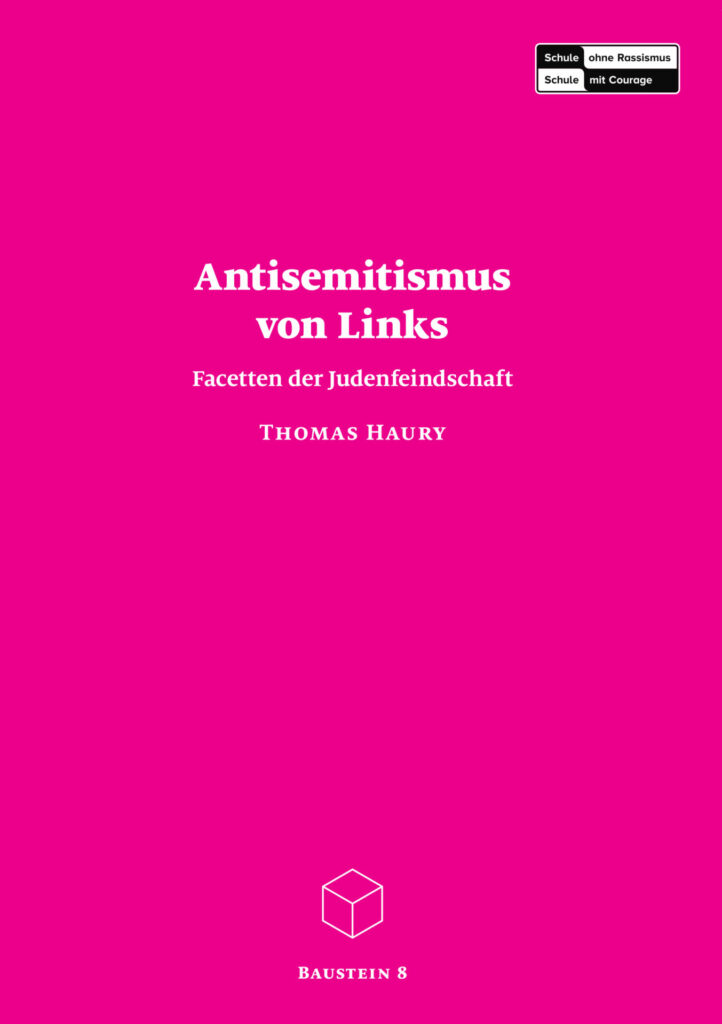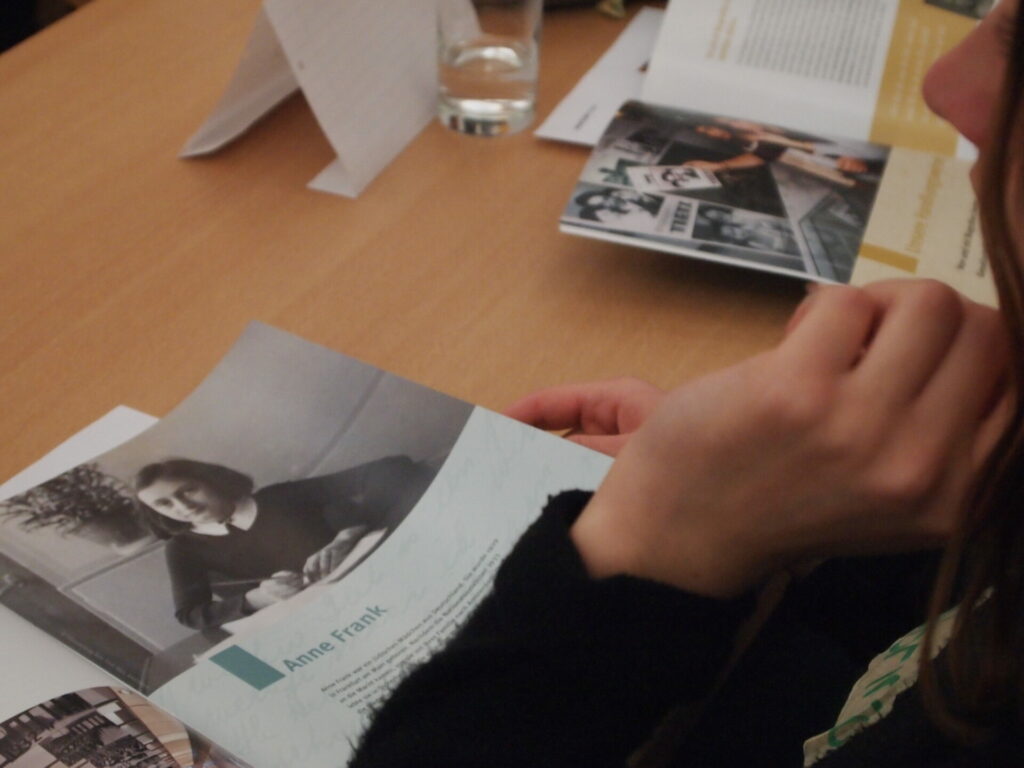Antisemitismus ist ein Sammelbegriff. Er bezeichnet unterschiedlich motivierte antijüdische Einstellungen und Handlungen. Diese können individuell und kollektiv sein, treten in vielfältigen Erscheinungsformen auf und sind in verschiedenen gesellschaftlichen Milieus verbreitet. Nicht nur unter Neonazis, islamistischen Gruppen und Verschwörungsanhängern, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Mehr zum Thema findet ihr auch in den
Mehr zum Thema findet ihr auch in den Bausteinen „Antisemitismus und Migration“, „Antisemitismus von Links“ und im Themenheft „neuer deutscher extremismus*“.
Jahrhunderte alt
Der Antisemitismus entstand im 19. Jahrhundert mit der Bildung europäischer Nationalstaaten. Aber er basiert auf einer jahrhundertalten Tradition: der des christlichen Antijudaismus. Die Rassenideologie gibt dem Antisemitismus im 19. Jahrhundert eine politische Prägung. Antisemitismus ist mehr als der bloße „Hass“ auf Juden. Er lässt sich daher nicht einfach mit anderen Formen der Diskriminierung gleichsetzen.
Der biologistisch begründete Antisemitismus, der behauptet, Jüdinnen*Juden seien eine „Rasse“, entstand im 19. Jahrhundert. Er basiert auf der jahrhundertealten antijüdischen christlichen Alltagskultur und ihren einschlägigen Stereotypien. Dazu kam eine pseudowissenschaftliche Theorie, die soziale Hierarchien biologisch oder kulturell erklärte. Einen verstärkt aggressiven Charakter erhält der biologistische Antisemitismus durch die besondere „völkische“ Form der deutschen Konstitution der Nation. Denn das antisemitische Klischee der „Kulturlosigkeit“ alias „Verjudung“ alias „internationales Judentum“ ermöglicht den Antisemit*innen eine pseudo-antikapitalistische Attitüde.
Und heute?
Nach dem Holocaust und der Niederringung des Faschismus 1945 war der offene Antisemitismus in Deutschland gesellschaftlich geächtet. Trotzdem ist er in der Alltagskultur nicht verschwunden. Zahllose Redewendungen wiederholen mehr oder weniger bewusst uralte Klischees: So ist die Idee, das Judentum sei eine Religion starrer Gesetze und predige Rache, Unfug. Im öffentlichen Diskurs ist sie trotzdem präsent – vor allem in der sprichwörtlichen Redewendung des alttestamentarischen „Auge um Auge“ (das Prinzip des Schadensersatzes soll die Blutrache verdrängen) oder der ebenso sprichwörtlichen Figur des „hochmütigen“ Pharisäers, der für „den Juden“ steht.
Doch die zentrale Aussage aller antisemitischen Ideen ist immer, die Jüdinnen*Juden seien selbst schuld daran, dass sie diskriminiert und verfolgt würden. Diese These ist so alt wie der Antisemitismus selbst.
Im „sekundären Antisemitismus“, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, hat die Schuldabwehr eine große Bedeutung. Er bedient sich einer Verharmlosung und Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen bis hin zur Täter-Opfer-Umkehr. Zum Beispiel in der Behauptung, „die Juden“ und Israel würden den Holocaust instrumentalisieren. Sie wollten damit systematisch Schuldgefühle auslösen und Vorteile erlangen.
Zur Auseinandersetzung mit diversen Aspekten des Antisemitismus organisieren wir Workshops in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern wie dem Jüdischen Museum Berlin, dem Anne Frank Zentrum und der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA).
Antisemitismus tauch in unseren Klassen oft im Kontext der „Nahost-Frage“ auf, dies erfordert einen professionellen Umgang mit der Thematik. Die Landeskoordination Berlin organisiert Workshops in Zusammenarbeit mit unseren kompetenten Partnern wie ufuq.de, KIgA und dem Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment in der Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Auch in den Beiträgen der jährlich erscheinenden Schüler*innenzeitung q.rage und der Q-rage! online setzen sich Schüler*innen immer wieder mit Antisemitismus auseinander.